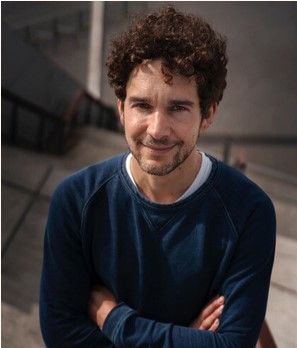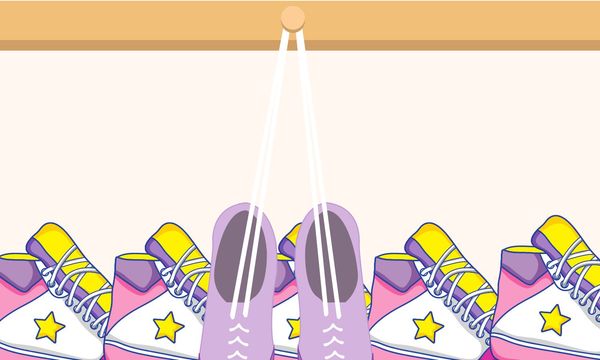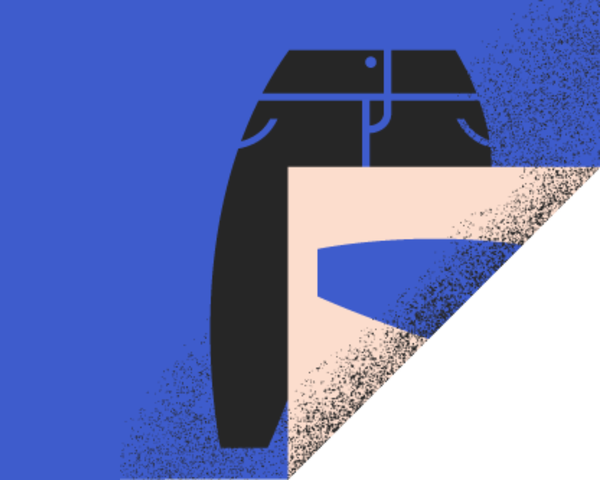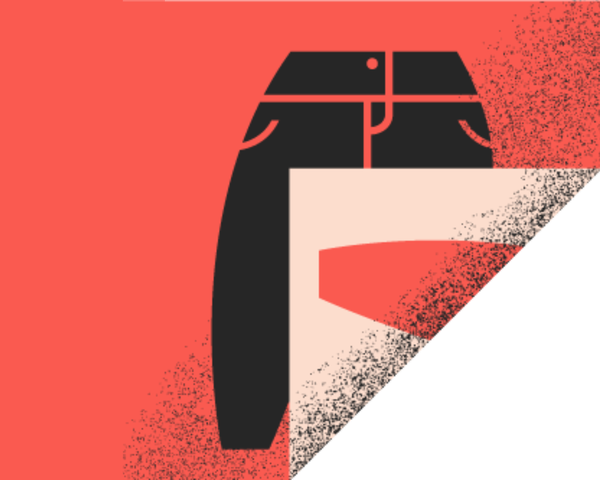Würde Robert Taylor sich auf die Veranda seines Hauses stellen und von dort auf jedes Haus in seiner Straße zeigen, in dem ein Mensch an Krebs erkrankt ist, könnte er kein einziges Haus auslassen. Seit 1968 lebt Taylor in der East 26th Street in der Gemeinde St. John the Baptist Parish im US-Bundesstaat Louisiana. Seine Straße ist aber nur noch unter einem Namen bekannt: „Cancer Alley“, die Krebs-Gasse.
Taylor ist ein älterer, schmaler, schwarzer Mann mit weiß gewordenen Haaren. Seine Geschichte erzählt er in einem Videogespräch. „Krebs ist keine leichte Art zu sterben“, sagt er. Seine Mutter, sein Onkel und zwei Cousins starben an Krebs. Auch seine Frau erkrankte 2003 an Brustkrebs, überlebte aber. Insgesamt ist das Krebsrisiko in St. John the Baptist Parish 50-mal höher als im Rest des Landes.
Der Grund dafür ist wohl eine Chemiefabrik, ein grauer Industriekomplex, keine 400 Meter von Taylors Haus entfernt. Errichtet wurde sie Mitte der 1960er Jahre von DuPont, einem der größten Chemiekonzerne der Welt. Hergestellt wird in ihr Chloropren, ein Stoff, der wiederum für die Herstellung von Neopren benötigt wird, also jenem Material, das etwa Surfer:innen warm hält, wenn sie im Meer stundenlang auf Wellen warten und sie dann reiten. Für Surfer:innen sind Anzüge aus Neopren so etwas wie eine zweite Haut. Sie schützen vor Kälte und Sonne, sind wasserundurchlässig, leicht und dehnbar.
Wer an Surfen denkt, hat automatisch Bilder von kristallklarem Wasser und goldenen Stränden im Kopf. Surfmarken wie die australischen Unternehmen Billabong und Rip Curl vermalkrten ihr Produkte häufig mit dem Traum von Freiheit, Abenteuer und einem Leben im Einklang mit der Natur. Das Geschäft mit der Surfausrüstung ist aber auch eine Milliarden-Dollar-Industrie. Alleine mit Wetsuits haben Unternehmen 2022 über 1,7 Milliarden Dollar umgesetzt. Fast immer bestehen die Anzüge dabei aus Neopren.
Sorgt die Surfindustrie also mit dafür, dass in der “Cancer Alley” Menschen sterben? Ist das die schmutzige Seite des Geschäfts?
Einer der ersten, der die Auswirkungen von Chloropren untersucht hat, ist der Forscher Ronald Melnick. Als leitender Toxikologe betreute er Anfang der 1990er Jahre ein Forschungsprojekt in Washington. Mittlerweile ist er in Rente. Im Gespräch aber merkt man, dass ihn der Fall bis heute nicht loslässt. Über zwei Jahre lang leiteten Melnick und seine Kolleg:innen Chloropren-Gas in kleine Kammern, in denen Ratten und Mäuse lebten. Starben die Tiere, ließ Melnick sie aufschneiden. Seine Kolleg:innen begannen Tumore in den Körpern der Nager zu zählen. Am Ende sahen sich ein Dutzend Wissenschaftler:innen Melnicks Forschung an. Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Das Chloropren-Gas, das die Mäuse und Ratten eingeatmet hatten, war krebserregend.
Dann aber passierte jahrelang nichts. Erst 2015, nachdem die US-amerikanische Agentur für Umweltschutz (EPA) Chloropren als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen eingestuft hatte, wurde der Chemiekonzern DuPont tätig. Allerdings schloss er die Fabrik nicht, sondern verkaufte sie an das japanische Unternehmen Denka, ebenfalls ein großer Chemiekonzern. „DuPont wollte sich aus der Verantwortung stehlen", sagt Ron Melnick, der Forscher. Der Betrieb der Fabrik ging weiter. Viele der rund 45.000, überwiegend schwarzen Einwohner der Gemeinde hatten zwar die Vermutung, dass die vielen Krebsfälle mit der Fabrik zu tun hatten. Sicher sein aber konnten sie sich nicht. Erst 2016 wurden sie von der EPA auf einer Versammlung im Rathaus der Gemeinde offiziell informiert, dass es die Chloropren-Fabrik sei, die so viele von ihnen krank mache.

Seit einigen Jahren werden die Chloropren-Werte nun regelmäßig gemessen, auch um die Menschen an Tagen mit besonders hohen Emissionen zu warnen. Das sind Tage, an denen Robert Taylor und seine Nachbarn ihre Häuser nicht verlassen. Der 10. Oktober 2022 war so ein Tag. Da stellte das Luftmessgerät, das sich nur wenige Blocks von der Anlage entfernt befindet, einen Chloropren-Wert von 118,0 Mikrogramm pro Kubikmeter fest. Dieser Wert ist fünfhundert Mal so hoch wie der Grenzwert, der laut EPA noch als ungefährlich gilt.
In einer freiwilligen Vereinbarung mit dem Louisiana Department of Environmental Quality hat sich Denka zwar verpflichtet, die Emissionen um 85 Prozent zu reduzieren. Das US-Justizministerium aber hält sie immer noch für zu hoch und krebserregend. Es ist ein ständiges Hin-und-Her. Ein neues Gesetz aus diesem Jahr soll Denka verpflichten, die Emissionen zu senken. Der Konzern aber hat es angefochten, um sich Zeit zu verschaffen. Unterstützung bekommt er vom republikanischen Gouverneur Jeff Landry. Der will die Standards verhindern, da sie die Schließung des Werks bedeuten könnten und damit auch den Verlust von Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen.
Auf eine Anfrage der Flip-Redaktion geht Denka nicht ein und schickt als Antwort nur Pressemitteilungen der vergangenen Jahre. In denen heißt es, man wolle gegen die “fehlerhafte und veraltete Wissenschaft” und die “unangemessene Regelung der EPA kämpfen”. Das Unternehmen kündigte darin aber auch an, in Zukunft Emissionen im Werk zu reduzieren.
Es geht in diesem Streit nicht nur um Robert Taylor und die anderen Bewohner der Gemeinde St. John the Baptist Parish. Ähnliche Fabriken stehen auch anderswo auf der Welt. Neopren, das auch Chloropren-Kautschuk genannt wird, ist nach wie vor ein gefragtes Material. Es wird in der Auto- und Medizinindustrie genutzt. Aber eben auch für Wetsuits zum Surfen oder Tauchen. Muss das wirklich sein?
Eigentlich nicht. Denn es gibt Alternativen. Eine davon hat der Amerikaner Jeff Martin entwickelt. Mit seiner Firma Yulex Corporation stellt er schon länger medizinische Produkte aus Naturkautschuk her. Durch einen Blogbeitrag der Outdoor-Marke Patagonia erfuhr er vom Neopren-Problem im Surfsport. Martin und sein Team stellten daraufhin ein Muster eines neoprenähnlichen Schaumstoffs aus Naturkautschuk her und präsentierten es Patagonia. Gemeinsam gründete man dann das Unternehmen Yulex LLC, das die Neopren-Alternative auf Pflanzenbasis herstellt. Seit 2016 hat Patagonia alle auf Neopren basierenden Produkte erfolgreich auf Yulex-Schaum umgestellt.

Seine Technologie hat Yulex an Hersteller in Japan und Taiwan weitergegeben. Anstatt sie zu monopolisieren, will das Unternehmen sie mit der Industrie teilen. Surfmarken wie Finisterre und Wallien stellen bereits Anzüge aus dem Schaum her. Im Juni dieses Jahres verkündete auch Decathlon, einer der weltweit größten Sportartikelhersteller, ihn für Wetsuits und Schnorcheloberteile zu verwenden.
Natürlich bringt die Verwendung von Naturkautschuk eigene Probleme mit sich. Um Platz für Kautschukplantagen zu schaffen, werden häufig Regenwälder gerodet und es gibt viele Berichte über schlechte Arbeitsbedingungen und geringe Löhne. Im Gespräch mit Flip erklärt Liz Bui, CEO von Yulex, wie das Unternehmen damit umgeht. Anfangs habe man es in Guatemala und Sri Lanka mit Plantagen von großen Konzernen zu tun gehabt, nach und nach aber die Lieferkette umgestellt. Ungefähr 1000 Kleinbäuer:innen arbeiteten nun für das Unternehmen. 2023 habe man ein Programm ins Leben gerufen, das ihre Löhne durch eine Gewinnbeteiligung verbessern soll. Auch eine abholzungsfreie Lieferkette versucht Yulex sicherzustellen und zertifiziert seinen Naturkautschuk mit PEFC- oder FSC-Zertifikaten. Im Vergleich zu Neopren auf Erdölbasis habe das Material auch eine bessere Klimabilanz. Laut einer eigenen Berechnung, die Yulex hier transparent macht, sind es 80 Prozent weniger CO2-Emissionen. Die Daten dafür stammen aus einer unabhängigen Studie, in der die CO2-Emissionen von Kleinbauern in Thailand analysiert wurden.
Das Problem sei, dass viele Surfer:innen immer noch gar nicht wissen, wie giftig Neopren ist, sagt Liz Bui. „Aber es zeichnet sich ein Wandel ab.“ Die australische Profi-Surferin Nikki van Dijk surft bereits in Neopren-Anzügen aus Yulex-Schaum. Bis dieser Wandel jedoch wirklich vollzogen ist, sorgt auch die Surfindustrie weiterhin dafür, dass sich das Geschäft schmutziger Fabriken wie der in Louisiana lohnt.