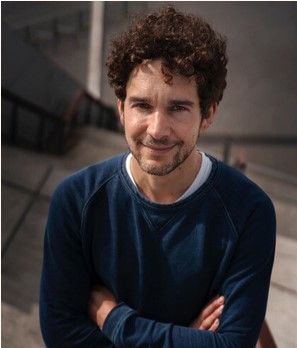Eine Klimasteuer für Reiche
Im Herbst 2021 feilt Bill Magavern im kalifornischen Sacramento an einem Gesetzestext. Er muss präzise sein, darf aber auch nicht zu technisch klingen, schließlich sollen alle Kalifornier ihn verstehen und darüber abstimmen können. Das fällt ihm, dem Juristen, der sonst eher für Experten schreibt, gar nicht so leicht. Mehrere Monate ringen er und seine Mitstreiter um jedes Wort. Dann ist sie fertig, die Proposition 30, die zwei der ganz großen Themen unserer Zeit miteinander verzahnen soll.
Was anschließend passiert, macht Bill Magavern noch immer fassungslos. Seit vielen Jahren kämpft er für saubere Luft und mehr Klimaschutz in Kalifornien. Coalition for Clean Air heißt die Organisation, für die er arbeitet. Magavern, ein eher nüchterner Typ in Holzfällerhemd, hat schon einige Schlachten geschlagen. So eine aber hat auch er noch nicht erlebt. Feuerwehrleute kämpfen in ihr gegen Milliardäre, Umweltschützer gegen Lehrerinnen, ein Gouverneur mit Präsidentschaftsambitionen gegen seine eigene Partei. Auch die Schauspielerin Jane Fonda mischt sich ein, genau wie Netflix-Gründer Reed Hastings.
Genug Stoff für eine Serie böte das kalifornische Drama allemal. Zumal es in ihm um eine Frage geht, die nicht nur in den USA zu den politisch brisantesten überhaupt gehört: Ist es an der Zeit, die Reichen im Kampf gegen den Klimawandel und seine Folgen stärker zur Kasse zu bitten? Genau das nämlich sieht die Proposition 30 vor. Jeder, der in Kalifornien mehr als zwei Millionen Dollar im Jahr verdient, soll für den Kampf gegen den Klimawandel und seine Folgen eine Extrasteuer von 1,75 Prozent bezahlen. “Meiner Organisation ging es vor allem um das Geld für den Klimaschutz”, sagt Magavern. “Ich persönlich glaube aber auch, dass es richtig ist, die Reichen stärker zu besteuern.”
Damit ist er nicht allein. Sowohl in den USA als auch in Europa zeigen Umfragen, dass die meisten Menschen sich eine stärkere Besteuerung der Reichen wünschen. Die Corona-Pandemie hat dieses Gefühl noch verschärft. Selbst der Internationale Währungsfonds, einst so etwas wie der Inbegriff neoliberalen Denkens, fordert inzwischen eine Vermögenssteuer, um die Kosten der Pandemie gerechter zu verteilen. Nur mit der größten aller Krisen, dem Klimawandel, wurde die Debatte bisher kaum verknüpft.
Das Problem sind die Reichen
Das allerdings ändert sich gerade. Die Hilfsorganisation Oxfam veröffentlicht seit einiger Zeit nicht mehr nur Zahlen zum Vermögen der Superreichen, sondern auch zu deren gigantische Emissionen. Der britische Think Tank Autonomy fordert in Großbritannien eine CO₂-Steuer für das reichste Prozent der Bevölkerung. Und auch Philippe Benoit vom Center on Global Energy Policy der Columbia Universität in New York fragt in einem Beitrag für Ethics & International Affairs, ob eine “Sondersteuer für die Luxusemissionen der Reichen” nicht vernünftig wäre.
Man kann die Proposition 30 deshalb auch als einen politischen Testballon begreifen. Dass er ausgerechnet in Kalifornien startet, ist wohl kein Zufall. Wie in kaum einem anderen US-Staat ist der Klimawandel hier längst im Alltag der Menschen angekommen. Waldbrände verwüsten riesige Flächen. Aus Angst vor Naturkatastrophen verlassen inzwischen mehr Menschen den Küstenstaat, als neue hinzukommen. Gleichzeitig gibt es in Kalifornien so viele Millionäre und Milliardäre wie sonst nirgendwo in den USA. Silicon-Valley-Größen wie Marc Zuckerberg leben in schicken Villen neben Hollywoodstars und Hedgefondsmanagern. Hier kann man schon mal auf die Idee kommen, sich das Geld für den Klimaschutz dort zu holen, wo es mehr als reichlich vorhanden ist.
Auch in Paris, am vom berühmten Ökonomen und Ungleichheitsforscher Thomas Piketty gegründeten World Inequality Lab, ist das Thema längst angekommen. Es ist hier vor allem sein Co-Direktor Lucas Chancel, der mit neuen spektakulären Zahlen für Aufsehen gesorgt hat. Mit Mitte 30, Brille und Dreitagebart würde Chancel auch gerade noch so als Student durchgehen. Er gehört zu jener Generation von Ökonomen, die mit dem Klimawandel aufgewachsen sind. Das Thema, sagt er, habe ihn schon in der Schule beschäftigt. Nun hat er riesige Datenmengen zu den individuellen CO₂-Emissionen aus mehr als hundert Ländern mit denen des World Inequality Lab zur Ungleichheit kombiniert. In einem Satz zusammengefasst lautet das Ergebnis: Das Problem sind die Reichen.

Wer zum oberen Prozent der Einkommensverteilung innerhalb der Weltbevölkerung gehört, hat laut Chancels Daten einen CO₂-Fußabdruck von durchschnittlich 101 Tonnen pro Jahr – der Durchschnitt aller Menschen liegt bei rund sechs Tonnen. Das aber ist noch nicht alles. Die Emissionen der Reichen wachsen auch besonders schnell – während die der ärmeren Hälfte der Bevölkerung in den USA und Europa seit 1990 bereits um 25 bis 30 Prozent zurückgegangen sind. Chancel kommt sogar zum Ergebnis, dass das, was die ärmere Hälfte der Menschen in den Industrieländern an CO₂ verursachen, oft schon oder nahezu im Einklang mit den nationalen Klimazielen für 2030 steht.
Das gilt nach einer Auswertung des World Inequality Lab auch für Deutschland. Die Menschen der ärmeren Hälfte der Bevölkerung verursachen demnach im Schnitt rund sechs Tonnen CO₂ pro Jahr. Damit liegen sie nur knapp über dem, was die Klimaziele der Bundesregierung für 2030 mit rund fünf Millionen pro Kopf vorsehen. Die einkommensstärksten zehn Prozent der Deutschen aber sind im Schnitt für 34 Tonnen pro Kopf verantwortlich, mehr als das Sechsfache des angestrebten Pro-Kopf-Ausstoßes für 2030. Die steigenden Emissionen der Reichen konterkarieren die Erfolge der ärmeren Hälfte der Bevölkerung.
Chancels Daten könnten die Art und Weise, wie wir über Klimagerechtigkeit nachdenken, durchaus verändern. Normalerweise geht es in der Debatte vor allem um die Verantwortung reicher und armer Länder. Seine Zahlen aber zeigen, dass es sich lohnt, auch auf die Unterschiede innerhalb der Länder zu schauen. “Wie hoch ein CO₂-Fußabdruck ist, hängt mittlerweile weniger davon ab, wo ein Mensch lebt, als davon, ob er innerhalb dieses Landes zu den Armen oder Reichen gehört”, sagt Chancel.

Vor diesem Hintergrund findet er, dass die derzeitige Politik der CO₂-Besteuerung ungerecht ist. Weil sie oft am Verbrauch ansetze – und die Armen damit härter treffe als die Reichen. In Frankreich konnte er vor ein paar Jahren die Proteste der Gelbwesten-Bewegung miterleben. Hunderttausende protestierten monatelang gegen die Politik von Präsident Macron. Es war vor allem eine Revolte der Provinzbewohner und der unteren Mittelschicht. Der Auslöser: eine geplante Ökosteuer auf Benzin und Diesel. Für Chancel sind die Proteste ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man für das Klima vor allem jene zahlen lässt, die wenig haben und auf ein Auto angewiesen sind, während man die Hauptverantwortlichen schont.
In Kalifornien soll es anders laufen. Und zu Anfang sieht es ziemlich gut aus für die Proposition 30. Das liegt auch an den Feuerwehrleuten. Für sie ist der Klimawandel keine abstrakte, sondern eine sehr reale Bedrohung. Die massiven Waldbrände bringen sie oft an die Grenze ihre Leistungsfähigkeit. Es fehlt an Personal, Ausrüstung und Atemschutzmasken. “Kein Wunder, dass besorgniserregend viele von uns unter posttraumatischen Belastungsstörungen, Suizidgedanken und Scheidungen leiden”, schreibt Bataillonschef Patrick Griffin in einem Kommentar für die Santa Cruz Sentinel und fordert dazu auf, für die Reichensteuer zu stimmen.
Auch in Spots, die in ganz Kalifornien im Fernsehen laufen, werben Feuerwehrleute für die Proposition 30. Nach Schätzungen würde sie dem Staat zwischen 3,5 und fünf Milliarden Dollar pro Jahr einbringen. Mit dem größten Teil des Geldes sollen Elektroautos gefördert werden, da der Verkehr in Kalifornien noch immer die größte Emissionsquelle ist. Rund ein Fünftel der Einnahmen soll aber auch an die Feuerwehrleute fließen, zur Bekämpfung von Waldbränden. Bataillonschefs wie Patrick Griffin finden, dass es richtig ist, die Reichen dafür stärker in die Pflicht zu nehmen. “Nicht ein einziger Kalifornier mit niedrigem oder mittlerem Einkommen müsste mehr Steuern bezahlen”, schreibt er.
Für viele Menschen klingt das nach einem gutem Plan. Bei einer Umfrage im September vergangenen Jahres geben 55 Prozent an, mit Ja stimmen zu wollen. Bis zur Abstimmung Anfang November sind es da nur noch ein paar Wochen.
Die Kritik an der Steuer
In Kalifornien lässt sich aber auch beobachten, was gegen eine solche Steuer ins Feld geführt werden kann. Eine Kritik kommt von der mächtigen Lehrergewerkschaft Kaliforniens, der California Teacher Association. Weil das Geld, das die Steuer einspielen würde, zweckgebunden in die Bekämpfung des Klimawandels fließe, sei es wie einem Schließfach gefangen – und könne nicht mehr für Schulen oder Universitäten ausgegeben werden, sieht Präsident Toby Boyd.
Eine weitere Kritik an der Proposition 30: Sie nimmt die Reichen quasi in Sippenhaft. Jeder und jede, die mehr als zwei Millionen Dollar verdient, soll die Steuer bezahlen, ganz egal, für wie viel CO₂ sie tatsächlich verantwortlich ist. Ob jemand im Privatjet durch die Gegend fliegt und sein Geld mit Kohlekraftwerken verdient oder ausschließlich in grüne Technologien investiert und sich Fernreisen verkneift, spielt keine Rolle. Die Steuer, so kann man es vielleicht zusammenfassen, würde eher wie eine Schrotflinte wirken: effektiv, aber nicht besonders genau.
Am Ende aber sind es nicht solche Argumente, die in Kalifornien entscheiden. Vielmehr geht es um Geld, politisches Kalkül und das Narrativ, das sich durchsetzt.
Ohne Geld, sagt Bill Magavern, sei eine Kampagne wie die für die Proposition 30 in den USA nicht zu stemmen. Allein das Sammeln der Unterschriften, die notwendig sind, um eine Abstimmung auf den Wahlzettel zu bekommen, habe mehrere Millionen Dollar gekostet. Man habe mit vielen möglich Spendern gesprochen. Am Ende aber ist es vor allem Lyft, ein Fahrdienstvermittler wie Uber, der 45 Millionen Dollar in die Kampagne pumpt. “Ohne Lyft”, sagt Magavern, “hätte es keine Proposition 30 gegeben.”
Genau das aber wird ihr zum Verhängnis. In Wahrheit, so streuen ihre Gegner, stecke mit Lyft ein Unternehmen hinter der Initiative, das sich mit Steuergeldern die eigenen Taschen vollmachen wolle. In Fernsehspots ist vom “Lyft-Grift” die Rede, vom Lyft-Schwindel. Richtig ist, dass Lyft indirekt von der Proposition 30 profitieren würde, die Unterstützung also keineswegs selbstlos ist. Bis 2030 nämlich müssen 90 Prozent der Autos von Lyft- und Uber-Fahrern elektrisch sein, so schreibt es Kalifornien vor. Die in der Proposition 30 vorgesehene Förderung spielt Lyft also in die Hände. Richtig ist aber auch, dass die Förderung auch jedem anderen zustünde, der auf ein Elektroauto umsteigt. Von allen Experten, die die Proposition 30 analysieren, findet keiner einen Hinweis darauf, das Lyft übermäßig profitieren würde.

Die Erzählung aber verfängt trotzdem. Und sie wird mit viel Geld gepusht. Netflix-Gründer Reed Hastings spendet eine Million Dollar an die No-Kampagne. Die Fisher-Brüder, Erben des Modekonzerns GAP, geben 1,8 Millionen Dollar. Hinzu kommen Hedgefondsmanager, Investmentbanker und die Witwe des früheren Levis-Chefs. Jane Fonda, die Schauspielerin, redet ihnen noch ins Gewissen. Reiche, denen ihr Reichtum wichtiger sei als eine lebenswerte Zukunft, sollten “ihre Prioritäten überdenken.” Doch die Gegenkampagne ist in vollem Gange. “Ich habe wirklich geglaubt, die Superreichen würden sich zu sehr schämen, um mit ihrem Millionen den Klimaschutz zu sabotieren”, sagt Bill Magavern. “Leider habe ich mich getäuscht.”
Der größte Schock für Magavern aber ist, dass sich auch Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom gegen die Steuer stellt. “Lasst Euch nicht täuschen”, sagt er in TV-Spots. Was als Klimaschutzinitiative daherkomme, sei in Wahrheit die Kampagne eines Unternehmens, das viel Geld verdienen wolle. Er übernimmt damit die Erzählung der No-Kampagne – und stellt sich gegen seine eigene Partei, die Demokraten, die die Pläne befürwortet. Warum er das tut, ist bis heute nicht ganz klar. Viele glauben, dass es auch etwas mit Präsidentschaftsambitionen zu tun hat, die man ihm nachsagt. Er habe es sich wohl mit Geldgebern und konservativen Wählern nicht verscherzen wollen, vermutet auch Bill Magavern.
Das alles zeigt, dass es kein Selbstläufer ist, die Reichen für den Klimaschutz stärker zu besteuern. Im November stimmen 42 Prozent der kalifornischen Bevölkerung für die Proposition 30. 58 Prozent sind dagegen. Die Stimmung hat sich innerhalb von ein paar Wochen gedreht.
Die Debatte hat gerade erst begonnen
Das ist wohl erst der Vorgeschmack auf eine Debatte, die nicht nur den USA bevorsteht. Lucas Chancel, der junge französische Ökonom, tüftelt bereits an eigenen Ideen für eine CO₂-Reichensteuer. Ebenso Willi Semmler, ein Professor mit grauem Wuschelkopf, der auch mit über 80 Jahren noch an der New School in New York lehrt und Organisationen wie den Internationalen Währungsfonds berät. Mehr als eine Generation trennen ihn und Chancel voneinander. Ihre Ideen aber sind sich erstaunlich ähnlich.
Beide setzen bei einer überraschenden Erkenntnis an. Bei den Emissionen der Reichen denken wir vor allem an Jachten, Villen, beheizte Pools und Privatflugzeuge. Und in der Tat entsprechen die mit ihrem Lifestyle verbundenen Emissionen bei Milliardären laut Oxfam dem Tausendfachen eines Normalbürgers. Auch hier lässt sich ansetzen, etwa mit einer CO₂-Steuer auf Luxusgüter wie Privatflugzeuge oder Jachten, wie sie Philippe Benoit vom Center on Global Energy Policy der Columbia Universität vorschlägt.
Chancel und Semmler aber schwebt etwas anderes vor. Denn: Noch schädlicher als der Konsum der Reichen sind ihre Investitionen, vor allem in Unternehmen. Beim oberen Prozent der Weltbevölkerung, so hat es Chancel ausgerechnet, sind die Investitionen für mehr als 70 Prozent der gesamten Emissionen verantwortlich.
Chancel plädiert deshalb für eine Steuer auf die mit dem Vermögen verbundenen Emissionen. In ihrer simpelsten Form würde sie so funktionieren, dass einem Aktionär, dem etwa ein Prozent der Volkswagen-Aktien gehören, auch ein Prozent der direkten Emissionen von Volkswagen zugerechnet würde. Auf jede dieser ihm zugerechneten Tonnen müsste er dann eine Steuer zahlen, 150 Euro zum Beispiel. Da allein Volkswagen für Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr direkt verantwortlich ist, käme so eine ganze Menge Geld zusammen. In Deutschland wären es nach Chancels Berechnungen rund 95 Milliarden Euro pro Jahr. Zwar müsste grundsätzlich jeder Aktionär die Steuer zahlen. Sie würde aber vor allem Reiche treffen, weil diese besonders viel Geld in CO₂-intensive Unternehmen pumpen, sagt Chancel. Die Steuer wirke daher progressiv.
Auch Willi Semmler schlägt eine CO₂-Vermögenssteuer vor, die ähnlich funktioniert. Wer in dreckige Unternehmen investiert, soll eine Extrasteuer auf die Gewinne daraus zahlen. Er hat sogar schon eine Liste von grünen und braunen Unternehmen erstellt. Diese sei zwar noch nicht perfekt, sagt er, aber die Daten würde aufgrund gesetzlicher Vorschriften in den USA und Europa immer besser.
Semmler hält eine solche “braune Reichensteuer” auch für politisch leichter durchsetzbar. Weil sie anerkenne, dass nicht jedes Vermögen schlecht sei, könnten auch liberale und konservative Politiker ihr eher zustimmen. Das Beste aber sei, dass man mit ihr “gleich drei Fliegen mit einer Klappe schlagen” würde: Die Ungleichheit würde verringert, der Klimawandel bekämpft und die Staaten hätten eine neue Einnahmequelle, um die nach der Corona-Krise arg strapazierten Haushalte aufzubessern.