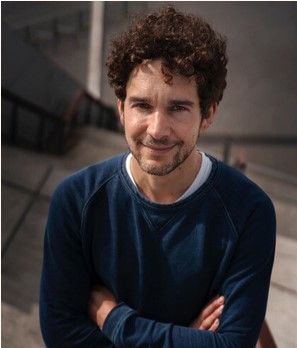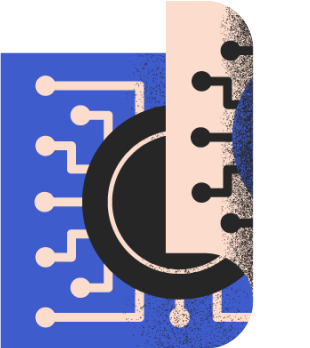Was ist das Problem?
Vermögen ist in Deutschland besonders ungleich verteilt. Auf der einen Seite häufen die Reichsten immer mehr Vermögen an, auf der anderen Seite wächst die Zahl der Menschen mit finanziellen Sorgen. Das ist erstmal nichts Neues, allerdings stieg die Vermögensungleichheit zuletzt wieder. Das liegt auch an der Rekordjagd an den Börsen, von der besonders die Reichsten profitieren und an der hohen Inflation, die besonders die Ärmsten trifft. Eine Folge:
2023 gibt es in Deutschland 300 Superreiche mit einem Vermögen von mindestens 100 Millionen Euro mehr als noch im Vorjahr. Die Vermögensungleichheit in Deutschland ist damit überdurchschnittlich hoch, wie eine BCG-Studie zeigt.
Bei den einen bleibt am Ende des Monats also kein Geld mehr übrig, weil alles teurer wird. Die anderen horten weiterhin so viel, dass sie es nicht mal ausgeben könnten. Das sorgt für Frust und schadet auch der Demokratie, wie eine Studie zeigt. Demnach sinkt das politische Engagement an Orten, die besonders ungleich sind.
Was ist der Ansatz?
Über Superreiche und ihren Einfluss wird aktuell viel berichtet: Einerseits biedern sich prominente Tech-Milliardäre beim künftigen US-Präsidenten Donald Trump an. Andererseits fordern immer mehr Institutionen wirkungsvolle Steuern gegen die große Ungleichheit. Die G20 etwa haben gerade in Brasilien einen Kompromiss zur stärkeren Besteuerung von Superreichen geschlossen. Von Greenpeace kommt ein konkreter Vorschlag für eine Milliardärssteuer in Deutschland. Und auf dem Wirtschaftsforum in Davos forderten sogar 260 Multimillionär:innen und Milliardär:innen: Besteuert uns endlich höher!
Noch einen Schritt weiter geht Ingrid Robeyns, eine bekannte Ökonomin und Philosophin, die Theorien gegen Ungleichheit entwickelt. Sie ist Professorin für Ethik an der Universität Utrecht und hat sich ein Konzept ausgedacht, das sie Limitarismus nennt. Dahinter steckt die Idee, dass es eine Obergrenze von 10 Millionen Euro für persönlichen Reichtum geben sollte. Niemand benötigt demnach mehr. Alles, was über diese Grenze hinausgeht, würde mit bis zu 100 Prozent besteuert, de facto also enteignet. Das könnte Robeyns zufolge einerseits extreme Ungleichheit verhindern und andererseits höhere Sozialausgaben finanzieren.

Sie sagt: "Niemand verdient es, Millionär zu sein. Nicht einmal Sie."
Was Robeyns vorschlägt, ist also ganz schön radikal, aber als akademisches Gedankenexperiment durchaus fruchtbar. Robeyns hat über ihre Theorie des Limitarismus ein fast 400-seitiges Buch geschrieben. Ihr Konzept zielt darauf ab, Reichtum zu begrenzen, mündet aber nicht in absolute Gleichmacherei. Denn auch der Limitarismus geht davon aus, dass eine Gesellschaft von einer gewissen Ungleichheit profitieren kann. Etwa weil Unterschiede in Einkommen und Vermögen Innovationen ankurbeln können. Doch wenn diese Unterschiede zu groß werden, beginnt das gesellschaftliche Gleichgewicht zu kippen, findet Robeyns.
🚨 Wusstest du schon, dass du alle Recherchen der letzten 12 Monate kostenlos lesen kannst?
Ja, du hast richtig gelesen. Für unsere Newsletter-Empfänger:innen haben wir sämtliche Artikel des letzten Jahres auf der Website freigeschaltet. Zusätzlich bekommst du jeden Freitag ein kurzes Briefing von uns, was sich in der letzten Woche beim nachhaltigen Umbau der Wirtschaft getan hat - oder eben nicht. Natürlich ebenfalls kostenlos. Also, schnell anmelden und nichts mehr verpassen!
Robeyns Vorschlag wird immer wieder als Sozialismus oder Kommunismus abgetan, wie sie selbst dem Spiegel sagt. Sie glaubt jedoch, man wolle ihre Argumente für den Limitarismus mit solchen Stempeln pauschal diskreditieren. Schauen wir uns ihren Vorschlag also genauer an.
Ist die Idee machbar, sinnvoll und gerecht?
Flip-Autor Lorenz Jeric hat mit dem Ökonom Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) gesprochen und sich das – nicht immer ganz einfache – Buch von Ingrid Robeyns vorgenommen. Darin argumentiert sie zwar vor allem theoretisch, trotzdem versuchen wir es möglichst konkret zu machen.
- Was würde eine Obergrenze für Vermögen bringen?
Eine Obergrenze hätte laut Robeyns mehrere Vorteile. Das erste Argument erschließt sich recht einfach: Einige Wenige müssten sich einschränken, viele Andere würden profitieren. So müssten die Reichsten auf den Teil ihres Vermögens verzichten, den sie nicht wirklich zum Leben brauchen. Trotzdem könnten sie weiterhin von den Erträgen ihres Kapitals leben oder auch teuren Hobbys nachgehen. Schließlich dürften sie 10 Millionen Euro behalten. Selbst Flüge ins All kann man davon noch bezahlen, eine eigene Rakete aber nicht.
Das mag vielleicht etwas übertrieben klingen, im Kern geht es dem Limitarismus aber genau darum. “Das ist der Preis, den wir dafür bezahlen, allen anderen Gruppen enorme Chancen zu eröffnen und unsere Gesellschaft gerechter zu machen”, schreibt Robeyns. Das abgeschöpfte Kapital solle dann so investiert werden, dass alle davon profitieren. Etwa in bessere Bildung, oder das Gesundheitswesen.
Stefan Bach, Wirtschaftsforscher am DIW Berlin beschäftigt sich mit Umverteilung und hat den Vorschlag für Flip einmal durchgerechnet. Er sagt: “Die Vermögenskonzentration in Deutschland ist sehr hoch, deshalb könnte eine solche Obergrenze theoretisch immenses Kapital mobilisieren.” Bach schätzt, dass im Jahr 2021 in Deutschland 90.000 Personen ein Nettovermögen von mehr als 10 Millionen Euro hatten. Deren Vermögen betrug 3100 Milliarden Euro, das macht gut 19 Prozent des gesamten Vermögens der privaten Haushalte von 16.000 Milliarden Euro aus. “Würde man bei diesen Personen die Vermögen oberhalb von 10 Millionen Euro abschöpfen, wären das gigantische 2200 Milliarden Euro – knapp 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Damit könnte man theoretisch fast alle Staatsschulden abbezahlen oder mehr als vier Jahre den Bundeshaushalt finanzieren”, sagt Bach.

Robeyns sieht in der Obergrenze aber noch einen zweiten Vorteil: Auch unsere Arbeit könnte gerechter werden, wenn der persönliche Reichtum von Manager:innen und Aktionär:innen gedeckelt wird. Wieso sollten sie weiter nach maximalem Profit streben, wenn sie am Ende sowieso alles abgeben müssen, was über 10 Millionen Euro hinausgeht? Stattdessen könnten Unternehmen ihre Gewinne endlich so verteilen, dass möglichst viele Angestellte profitieren und gerechte Gehälter für alle zahlen. In der Theorie klingt das einleuchtend, praktisch lässt sich dieser Effekt aber nicht einfach berechnen.
In der Vergangenheit gab es immer wieder Bewegungen, die ähnliches versuchten. Etwa in der Schweiz, wo 2013 eine Volksinitiative forderte, Manager:innen sollten monatlich nur noch das verdienen dürfen, was die am schlechtesten bezahlten Angestellten im Jahr verdienen. Die Initiative scheiterte nach der Lobbyarbeit reicher Schweizer:innen. Robeyns glaubt, eine Obergrenze könnte solche Ungleichheiten innerhalb von Unternehmen endgültig einschränken.
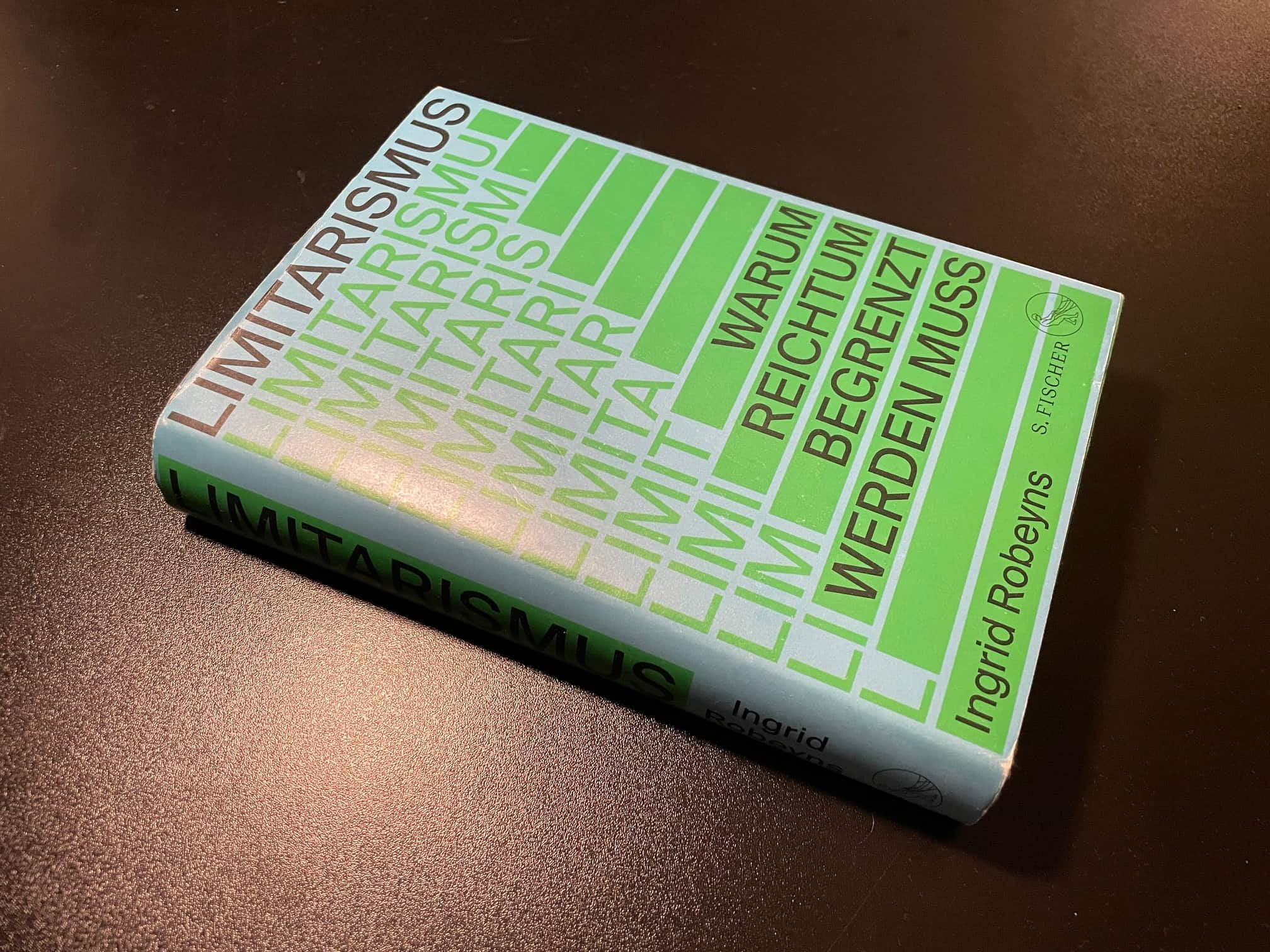
- Ist das überhaupt gerecht?
Natürlich lässt sich nicht pauschal sagen, was gerecht ist. Der Status Quo sei aber in jedem Fall ungerecht, findet Robeyns. Sie argumentiert, große Vermögen würden oft auf der Ausbeutung anderer Menschen basieren. Eines der unzähligen Beispiele ist Apple, das als derzeit wertvollste Unternehmen der Welt mit 3,41 Billionen US-Dollar bewertet wird. Während CEO Tim Cook vergangenes Jahr 49 Millionen US-Dollar verdiente, werden chinesische Arbeiter:innen in Apples Lieferkette offenbar nach wie vor ausgebeutet.
So ist der Wohlstand im globalen Norden mit all seinen großen Unternehmen und Superreichen mitverantwortlich für die krasse Armut im globalen Süden. Ähnlich sieht es auch innerhalb einzelner Länder und Unternehmen aus. Zwar ist das Gefälle nicht immer so krass, wie zwischen Tim Cook und den chinesischen Arbeiter:innen, trotzdem findet Robeyns die extreme Ungleichheit nicht zu rechtfertigen. “Was legal ist, entspricht nicht immer dem, was moralisch ist. Vor allem nicht, wenn es um Steuergesetze geht”, schreibt sie in ihrem Buch.
Längst haben auch viele Reiche erkannt, dass unbegrenzter Reichtum ungerecht ist. Schon lange vor dem diesjährigen Wirtschaftsforum Davos, wo sich 260 Multimillionär:innen und Milliardär:innen für höhere Steuern einsetzen, warben Superreiche für mehr Umverteilung. Der frühere Amazon-Investor und US-Milliardär Nick Hanauer beschrieb schon vor zehn Jahren, wie ungerecht und demokratiefeindlich sein Reichtum und der seiner Kolleg:innen und Bekannten sei.
- Könnte man das wirklich umsetzen?
Robeyns Antworten auf diese Frage sind ziemlich abstrakt. Theoretisch könne sich das neoliberale Weltbild, in dem viele Superreiche als Stars gesehen werden, mit der Zeit auch wandeln, meint sie. Warum sollte die Wirtschaft also für immer so bleiben wie heute?
Wir müssen den Neoliberalismus durch etwas Humaneres ersetzen, das Fairness zum Dreh- und Angelpunkt macht. – Ingrid Robeyns.
Dass das nicht von heute auf morgen passieren wird, weiß Robeyns. Sie begreift ihren Limitarismus daher auch eher als eine Idealvorstellung für die Zukunft.
Das theoretische Fernziel einer harten Vermögensobergrenze sei in der Praxis unmöglich umzusetzen, ist sich hingegen DIW-Forscher Bach sicher: „Das wäre schlicht eine Enteignung des Super-Reichtums, die verfassungsrechtlich nicht zu machen ist, ganz zu schweigen von den wirtschaftlichen und politischen Verwerfungen.“ Investoren würden dann einen Bogen um Deutschland machen und inländische Superreiche ins Ausland abwandern.
Eine Obergrenze für Vermögen wird es also kaum geben. Aber Robeyns schlägt viele kleinere Schritte vor, die auch einzeln schon gegen Ungleichheit helfen könnten. Konkret: Steuerflucht müsse effektiv verhindert werden, etwa indem Reiche ihr Vermögen tatsächlich dort versteuern, wo sie leben. Vermögen müsste, wenn schon nicht abgeschöpft, viel höher besteuert werden als bisher. Die Einkommensteuer für Spitzenverdiener und die Unternehmensteuern müssten erhöht werden. Erbschaften müssten höher besteuert und über ein Grunderbe umverteilt werden. Solche Schritte sind durchaus umsetzbar und werden - siehe oben - auch politisch diskutiert. (Auch Flip hat bereits über die Idee vom Grunderbe oder einer gerechteren Besteuerung von Firmenerben berichtet.)
Über solche Maßnahmen könne man diskutieren, findet auch Bach, auch wenn sie alles andere als einfach umzusetzen seien. Spürbare Steuern auf hohe Vermögen müsse man schon international koordinieren, meint er, zumindest zwischen der EU, den USA, Großbritannien und weiteren G20 Ländern. Und auch dann solle man es nicht übertreiben mit dem Schröpfen der Reichen. Denn zumindest innovative Unternehmer und engagierte Investoren brauche man dringend für das Funktionieren von Kapitalismus und Marktwirtschaft – und damit für den Wohlstand in der Welt. “Alternative Wirtschaftssysteme haben sich bisher nicht bewährt”, sagt Bach. “Die Kunst ist es, den Kapitalismus einzugrenzen, um die Ausbeutung von Menschen und Natur zu unterbinden, ohne seine innovative Kraft zu ersticken.”
Ob eine Vermögensobergrenze wirklich umsetzbar ist, ist also zweifelhaft, aber als radikaler Vorschlag gegen radikale Ungleichheit bereichert sie die aktuelle Diskussion um eine gerechtere Besteuerung von Superreichen durchaus.