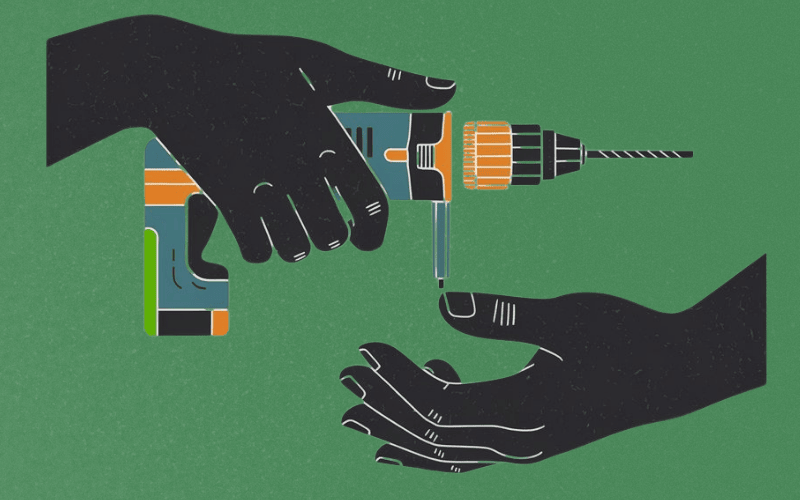Dem Arzt, der sich an uns wendet, ist Nachhaltigkeit wichtig. Rund 80 Prozent des Abfalls, der in seiner Abteilung anfalle, bestehe aus Wertstoffen, aus hochwertigen Kunststoffen, Papier, Pappe oder Glas. Trotzdem lande ein großer Teil davon im Restmüll. So sei es nicht nur in seiner Klinik. „Ich kenne kaum ein Krankenhaus in Deutschland, das tatsächlich Wertstoffe in größerem Maße trennt”, schreibt er.
Auf den ersten Blick scheint das absurd. Während viele von uns zu Hause dreimal überlegen, in welche Tonne etwa ein verschmutzter Pizzakarton gehört, landet in Krankenhäusern fast alles einfach im Restmüll? Für die Umwelt wäre das ein echtes Problem. Krankenhäuser sind in Deutschland der fünftgrößte Abfallproduzent, nur die Baubranche, der Handel, das Gewerbe und der Bergbau machen noch mehr Müll. Zusammengenommen geht es um 4,8 Millionen Tonnen im Jahr. Das entspricht dem Abfall von rund fünf Millionen privaten Haushalten.
Zunächst aber ist es nicht mehr als der Eindruck eines einzelnen Arztes. Beschreibt er wirklich ein deutschlandweites Problem? Und falls ja: Warum handeln Krankenhäuser dann so? Liegt es an strengen und notwendigen Hygienevorschriften? Oder ist die Idee einer Kreislaufwirtschaft im Gesundheitssektor einfach noch nicht angekommen?
Keine Zahlen, kaum jemand redet
Es ist von Anfang an eine zähe Recherche. Fast niemand will offen reden. Alles ist furchtbar kompliziert. Auch deshalb spielt das Thema in der Öffentlichkeit bisher kaum eine Rolle. „Diese unglaublichen Abfallmengen in Krankenhäusern werden einfach so hingenommen”, sagt Thomas Fischer, Experte für Kreislaufwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe. Er findet es „absolut wahnsinnig, was Krankenhäuser jeden Tag für Ressourcen verschwenden”.
Wie also nähert man sich dem Thema an? Als erstes versuchen wir, verlässliche Zahlen zu bekommen. Wie viel vom Krankenhaus-Müll landet wirklich im Restmüll, wird also nicht recycelt, sondern in der Regel verbrannt? Das Umweltbundesamt teilt uns mit, dass ihm keine „krankenhaus-spezifischen Zahlen” vorliegen, weder zur Mülltrennung noch zur Recyclingquote. Auch das Statistische Bundesamt hat keine Zahlen dazu, ebenso wenig das Bundesumweltministerium. Verlässliche Zahlen, das ist unsere erste Erkenntnis, gibt es nicht.
Das einzige, was es gibt, ist eine Befragung des Deutschen Krankenhausinstituts. In ihr gaben vor zwei Jahren 89 Prozent der Krankenhäuser an, eine “etablierte Abfalltrennkultur” eingeführt zu haben. Allerdings haben nur 133 Krankenhäuser von 1.900 in Deutschland mitgemacht. Und: Die Angaben wurden nicht überprüft.
Wir wollen uns ein eigenes Bild machen, sprechen mit Ärzt:innen, Pflegekräften und anderen Krankenhausmitarbeitenden. Insgesamt sind es 18 Mitarbeitende aus 13 Krankenhäusern. Was sie erzählen, zeichnet natürlich kein repräsentatives Bild, einen ersten Eindruck aber vermittelt es schon. Grob gesagt decken sich die Schilderungen von 16 der 18 Mitarbeitenden mit dem, was uns der Arzt geschrieben hat: Der Müll werde kaum getrennt. Plastikverpackungen, Infusionsbeutel, Gummihandschuhe – das alles lande zum Großteil im Restmüll.
Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens fehlen oft Trennbehälter. „Bei uns gibt es nicht einmal die Möglichkeit, Müll zu trennen”, sagt eine OP-Mitarbeiterin. Zweitens fehlt im Klinikalltag oft die Zeit. „Wir haben zwar einen Glascontainer auf der Station”, sagt eine Hebamme. „Aber der ist in einem eigenen Raum und kaum jemand hat Zeit, da jedes Mal hinzulaufen”. Eine Ärztin macht den enormen Kostendruck verantwortlich. „Es gibt schlicht kein Geld, um auf sowas zu achten.”
Ein weiterer Grund: Vieles könnte kontaminiert sein. „Wenn ein Patient isoliert wurde, schmeißen wir einfach alles aus seinem Zimmer weg”, sagt eine Medizinstudentin. Eine andere Mitarbeiterin erklärt, selbst hochwertige Metallscheren würden nur einmal genutzt. „Mir tränen die Augen, wenn ich sehe, was da alles weggeschmissen wird.” Einer, der sich richtig gut auskennt, sagt: „Ich kenne das Abfallmanagement von ungefähr 150 Krankenhäusern in Deutschland. Viele trennen nicht einmal die einfachen drei: Papier, gelbe Tonne, Rest.“
Die Schilderungen der Krankenhausmitarbeitenden werfen nicht nur Zweifel an den Ergebnissen der Umfrage auf. Sie stehen auch in Kontrast zu dem, was das Gesetz eigentlich vorschreibt. In Deutschland gilt seit 2012 für alle Betriebe, also auch für Krankenhäuser, das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Darin ist eine klare Abfallhierarchie festgelegt. An erster Stelle soll möglichst wenig Müll produziert werden. Unvermeidbare Abfälle sollten wiederverwendet werden. Wenn auch das nicht geht, schreibt das Gesetz vor, dass die Abfälle zumindest getrennt gesammelt werden müssen - noch an der “Anfallstelle”, also dort, wo der Müll anfällt, in Krankenhäusern zum Beispiel auf den Patientenzimmern. Nur wenn kein anderer Ausweg bleibt, dürfen die Abfälle verbrannt oder notfalls auf einer Deponie beseitigt werden.
Der Großteil des Mülls aus Krankenhäusern fällt zudem unter ein weiteres Gesetz, das auf dem Kreislaufwirtschaftsgesetz fußt: die Gewerbeabfallverordnung. Sie gilt seit 2017 für alle Produzenten von gewerblichen Abfällen, dazu zählen auch Krankenhäuser. In der Verordnung steht, dass der Müll, der dem von privaten Haushalten ähnlich ist – das gilt im Krankenhaus für den Großteil – getrennt werden muss: in Papier, Pappe, Glas, Kunststoffe, Bioabfälle. Das müssen die Unternehmen dokumentieren. Wer dagegen verstößt, kann mit einem Bußgeld von bis zu 100.000 Euro bestraft werden. Überprüfen sollen das alles die zuständigen Behörden der Kommunen.
Als wir in Hamburg nachfragen, wer genau die Kontrollen durchführt, antwortet zunächst die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA), dass sie nicht zuständig sei, sondern die Bezirksämter. Diese verweisen allerdings irritiert zurück an die BUKEA. Es dauert ein paar Wochen, bis das Zuständigkeits-Gerangel endlich geklärt ist. Fazit: Die BUKEA wäre verantwortlich gewesen, teilt aber mit, sie habe die Kliniken „in den letzten Jahren nicht” kontrolliert.
Wir fragen in 15 weiteren Städten nach: Berlin, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Dortmund, Essen, Bremen, Dresden, Hannover, Nürnberg, Duisburg und Kiel. Die Antworten unterscheiden sich im Detail, zeichnen insgesamt aber ein ähnliches Bild. Kontrolliert würde nur „anlassbezogen“, schreibt ein Bezirksamt in Berlin, also wenn es einen konkreten Verdacht gebe. „Unsere Personalausstattung erlaubt keine regelmäßige und flächendeckende Überwachung der Gewerbeabfallverordnung”, schreibt die Stadt Nürnberg. Die Überwachung von Krankenhäusern habe nicht die „oberste Priorität”, heißt es aus Kiel. In ihrer Gesamtheit lesen sich die Aussagen wie ein Eingeständnis: Kontrolliert wird so gut wie gar nicht. Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe nennt die Arbeit der Vollzugsbehörden eine „Totalverweigerung“. Die Gewerbeabfallverordnung nehme deshalb kaum jemand ernst. „Ohne Kontrolle ist das eine Verordnung für die Tonne.“
Es ist das erste Zwischenfazit unserer Recherche: In der Theorie gibt es zwar strenge Vorschriften zur Abfalltrennung. Diese aber sind in Kliniken besonders schwer umzusetzen – und werden in der Praxis kaum kontrolliert. Für die Krankenhäuser bedeutet das: Man kann versuchen, die Vorschriften mit viel Aufwand so gut wie möglich zu erfüllen. Lässt man es einfach bleiben, passiert aber auch nichts.
Unterwegs mit einem Abfallbeauftragten
Einer, der sich tagtäglich mit dem Thema auseinandersetzen muss, ist Heiko Schlüter. Er ist Abfallbeauftragter am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), einer der größten Kliniken Europas. Läuft man über das riesige Gelände, fühlt es sich an wie in einem eigenen Medizinviertel. Das UKE besteht aus mehr als 80 Kliniken und Instituten. Rund 15.000 Mitarbeitende arbeiten hier. Mehr als eine halbe Million Menschen werden jedes Jahr im UKE behandelt. Klar, dass an einem solchen Ort auch jede Menge Müll anfällt. 2022 waren es rund 5.000 Tonnen. So steht es im Nachhaltigkeitsbericht des UKE.
Heiko Schlüter trägt ein kariertes Kurzarmhemd und Wanderschuhe. Er ist 63 Jahre alt, lacht viel und grüßt fast jeden, der ihm entgegenkommt. Vor einer Müllpresse bleibt er stehen und drückt einen roten Knopf. Es quietscht und knarzt. Jede Woche drückt die Presse 4.000 Kilo Papier und Pappe zusammen. „Wenn dort ein falsches Teil landet, muss alles verbrannt werden“, sagt Schlüter. Das Entsorgungsunternehmen wäre „erstaunt”, wenn er falsch sortierten Müll abgeben würde. Insbesondere von Krankenhausmüll kann schließlich eine Infektionsgefahr ausgehen.

Was aber genau gilt als potenziell kontaminiert? Was ist zum Beispiel mit einer Zeitschrift, die ein Patient in der Hand gehalten hat? Theoretisch müsste das Personal jede einzelne Seite auf Blutflecken kontrollieren und jede andere Form der Kontamination ausschließen, damit sie recycelt werden darf. Doch dafür fehlt die Zeit. Das zeigt das Dilemma, in dem Krankenhäuser stecken: Einerseits sollen sie strenge Vorschriften einhalten. Andererseits ist völlig unklar, wie genau diese im Alltag einer Klinik überhaupt eingehalten werden können.
Schlüter sagt, die Krankenhäuser würden „zwischen allen Stühlen sitzen”. Und je länger man ihm zuhört, desto besser kann man das verstehen. Die Politik macht unklare, für Krankenhäuser nur schwer umzusetzende Vorschriften. Die Hersteller verpacken Produkte unnötig oft einzeln, außerdem gibt es zu viele Verbundverpackungen, die das Klinikpersonal im hektischen Alltag dann auch noch in ihre Bestandteile wie Plastik und Papier zerlegen müsste. Und dann sind da auch die privaten Entsorger, die die gelben Tonnen von den Krankenhäusern abholen. Auf sie ist Schlüter nicht besonders gut zu sprechen.
Dabei ist die Idee der gelben Tonne eigentlich gut: Sie wird kostenlos abgeholt, weil die Hersteller für jede Verpackung, die sie in Verkehr bringen, direkt eine Gebühr an ein privates Sammelunternehmen zahlen, das die gelbe Tonne dann später entleert. Weil die Abholung der Restmülltonne dagegen Geld kostet, lohnt sich die Mülltrennung. In der Theorie gilt das eigentlich auch für Krankenhäuser.
In der Praxis aber, sagt Schlüter, seien die gelben Tonnen viel zu klein. Außerdem müsse sich das UKE nach den festen Abholzeiten richten. Zusammengenommen führe das dazu, dass die gelben Tonnen oft schon viel zu früh voll sind. Wenn dann noch mehr Müll anfällt, landet er im Restmüll. „Das Plastik muss ja irgendwo hin”, sagt Schlüter. Verantwortung dafür trügen auch die privaten Entsorger. “Sie bekommen dafür Geld von den Herstellern, nehmen aber teilweise nicht alles mit.”

Spricht man mit dem Verband der privaten Entsorger, dem Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung, räumt dieser ein, dass es ein Problem gibt. Schuld daran aber seien nicht die privaten, sondern die kommunalen Entsorger, die ein Interesse daran hätten, „ihre Müllverbrennungsanlagen voll zu bekommen”, so Referent Thomas Probst, schließlich würden sie damit Geld verdienen. Krankenhaus-Müll enthalte häufig noch große Mengen Plastik, das einen hohen Heizwert habe und besonders gut brenne. Dieses Plastik stabilisiere daher die Müllverbrennung der kommunalen Entsorger.
Beim Verband kommunaler Unternehmen (VKU) wiederum sieht man die Verantwortung bei den Krankenhäusern. „Sie sind verantwortlich für die richtige Mülltrennung”, sagt ein Sprecher. Damit wäre man dann wieder ganz am Anfang der Kette von Schuldzuweisungen.
Es ist die zweite große Erkenntnis unserer Recherche: Niemand kann das Problem alleine lösen. Daran, es gemeinsam zu versuchen, haben Krankenhäuser, Hersteller und Entsorger bislang aber wenig Interesse. Es ist ein System, in dem jeder mit dem Finger auf den anderen zeigt.
Alle Verantwortlichen müssten an einen Tisch
Dass es nicht rund läuft, weiß auch die Politik. Ein Sprecher des Bundesumweltministeriums antwortet auf Anfrage von Flip: Die Gewerbeabfallverordnung habe sich zwar in ihrer Grundstruktur bewährt, „allerdings werden immer noch zu häufig Abfälle nicht getrennt gesammelt und Abfallgemische ohne Sortierung energetisch verwertet“, also verbrannt. Die Verordnung werde daher überarbeitet. Auch regelmäßige Kontrollen sollen künftig vorgeschrieben werden.
Fragt man die Abfallmanager der Krankenhäuser, was sie sich wünschen würden, hört man immer wieder den gleichen Satz: Eigentlich müssten sich alle Beteiligten mal an einen Tisch setzen und gemeinsam nach Lösungen suchen. „Das Problem beginnt beim Hersteller und geht über die Krankenhäuser bis zum Entsorger“, sagt auch Christina Moskau, die Abfallbeauftragte vom Klinikum Saarbrücken. Hier will man vormachen, wie es vielleicht gehen könnte. Das Krankenhaus beteiligt sich an einem Forschungsprojekt unter Leitung der Hochschule Pforzheim. Auch Hersteller von Medizinprodukten wie Carl Zeiss Meditec sind dabei, ebenso Deutschlands größtes Entsorgungsunternehmen Remondis.
Das Ziel: Gemeinsam für weniger Müll und mehr Recycling im Krankenhaus zu sorgen. „Wir hoffen”, sagt Christina Moskau, „dass nicht nur wir, sondern die ganze Branche davon lernen kann.”